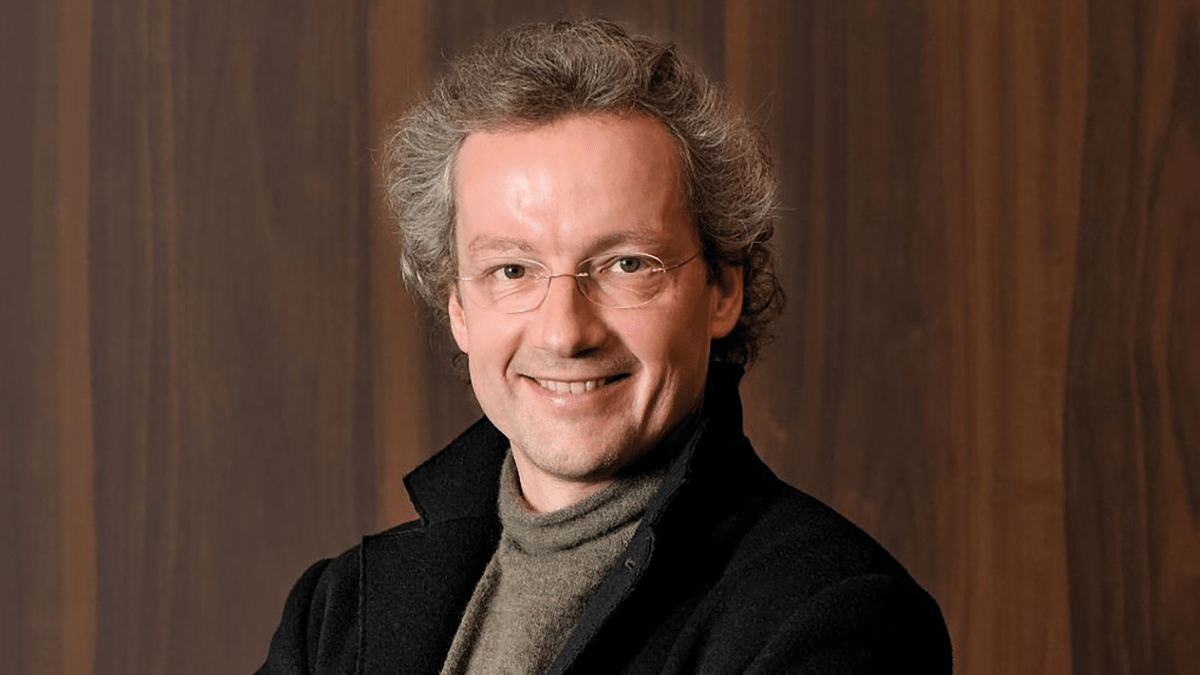Gianandrea Noseda & Beatrice Rana
Konzerteinführung: 18.45 Uhr
Vorverkauf ab Dienstag, 3. Dezember 2024, 9.00 Uhr
€ 84 | 73 | 58 | 48 | 36 | 21
Konzerteinführung: 18.45 Uhr
Vorverkauf ab Dienstag, 3. Dezember 2024, 9.00 Uhr
€ 84 | 73 | 58 | 48 | 36 | 21
Konzerteinführung: 17.45 Uhr
Vorverkauf ab Dienstag, 3. Dezember 2024, 9.00 Uhr
€ 84 | 73 | 58 | 48 | 36 | 21

Programm
Mitwirkende
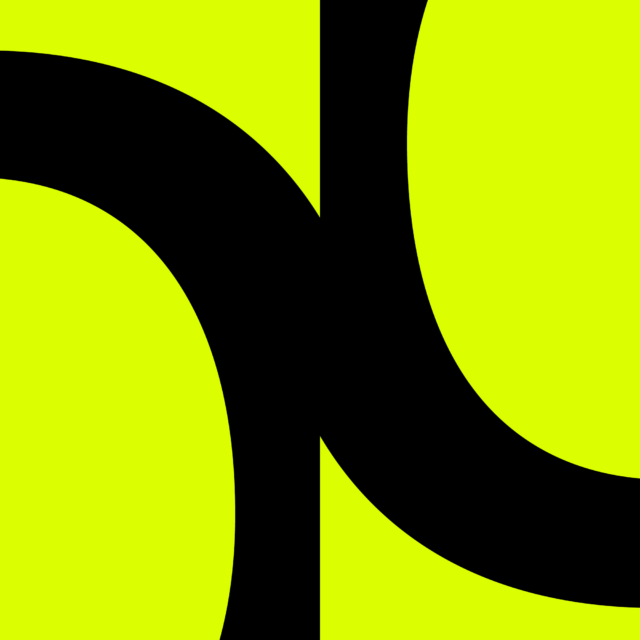
Abonnement
Die Konzerte am Donnerstag und Freitag sind Teil der Aboreihe A, das Konzert am Samstag Teil der Aboreihe S.
Werden Sie Abonnent*in des BRSO, sparen Sie bis zu 35% im Vergleich zum Einzelkartenkauf und profitieren Sie von zahlreichen weiteren Vorteilen!

Echtzeit
Moderierte Orchesterprobe – Von Schüler*innen für Schüler*innen
Mittwoch, 26. Februar 2025, um 10.00 Uhr
Dauer: ca. 1 Stunde
Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich