Jakub Hrůša & Joshua Bell
Donnerstag
17
Oktober 2024
20.00 Uhr
München, Münchner Residenz, Herkulessaal
Konzerteinführung: 18.45 Uhr
Vorverkauf ab Dienstag, 23. Juli 2024, 9.00 Uhr
€ 84 | 73 | 58 | 48 | 36 | 21 | 15
ABO D
Freitag
18
Oktober 2024
20.00 Uhr
München, Münchner Residenz, Herkulessaal
Konzerteinführung: 18.45 Uhr
Vorverkauf ab Dienstag, 23. Juli 2024, 9.00 Uhr
€ 84 | 73 | 58 | 48 | 36 | 21 | 15
ABO D
Programm
Leoš Janáček
Suite aus der Oper »Osud«
Henri Wieniawski
Violinkonzert Nr. 2 d-Moll, op. 22
Pause
Witold Lutosławski
Konzert für Orchester
Mitwirkende
Jakub Hrůša
Dirigent
Joshua Bell
Violine
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
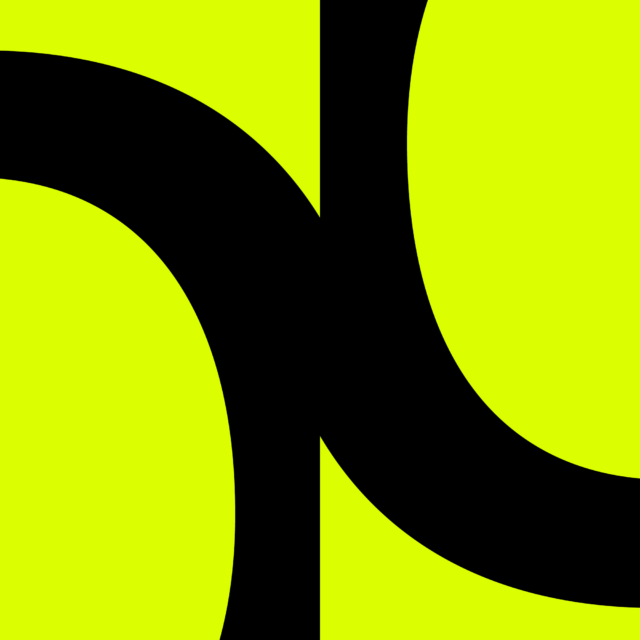
Abonnement
Die Konzerte sind Teil der Aboreihe D.
Werden Sie Abonnent*in des BRSO, sparen Sie bis zu 35% im Vergleich zum Einzelkartenkauf und profitieren Sie von zahlreichen weiteren Vorteilen!







