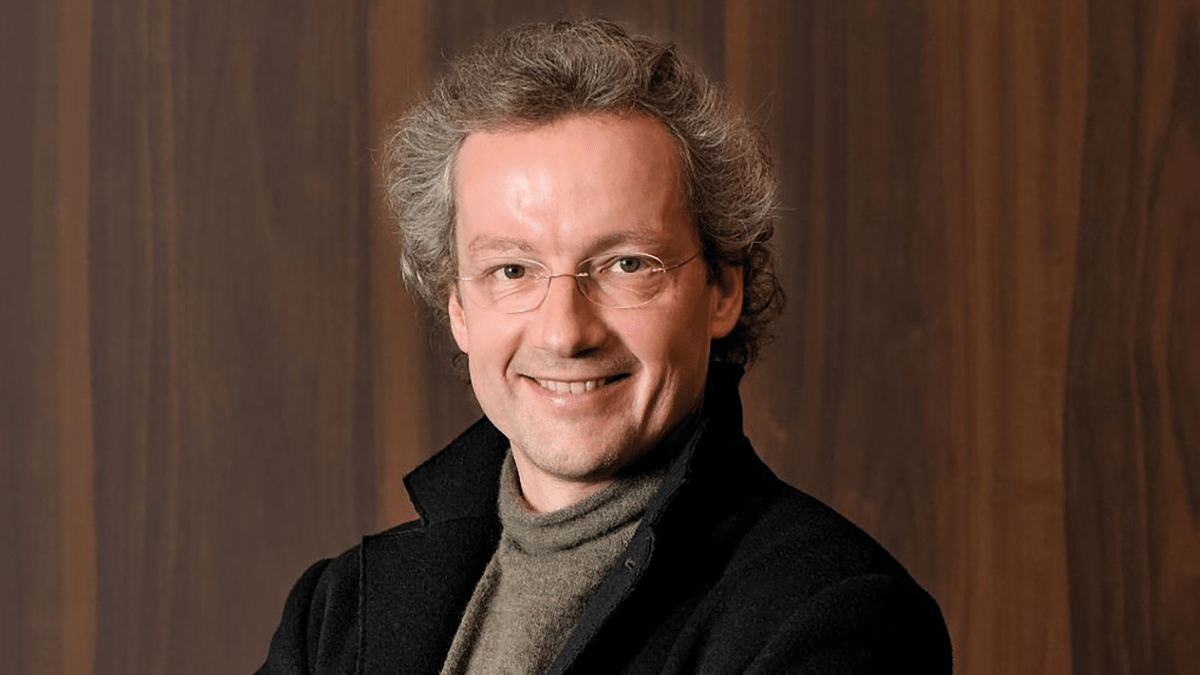Kammerkonzert
Zum 200. Geburtstag von Bedřich Smetana
Samstag
18
Januar 2025
20.00 Uhr
München, Münchner Residenz, Max-Joseph-Saal
Vorverkauf ab Dienstag, 5. November 2024, 9.00 Uhr
€ 28 | 23 | 17
Kammerkonzert
Sonntag
19
Januar 2025
Kammerkonzert

Programm
Bedrich Smetana
Streichquartett Nr. 1 e-Moll (»Aus meinem Leben«)
Gideon Klein
Streichtrio
Pause
Antonín Dvořák
Klavierquintett A-Dur, op. 81
Mitwirkende
Karin Löffler
Violine
Celina Bäumer
Violine
Giovanni Menna
Viola
Uta Zenke-Vogelmann
Violoncello
Anne Schätz
Klavier
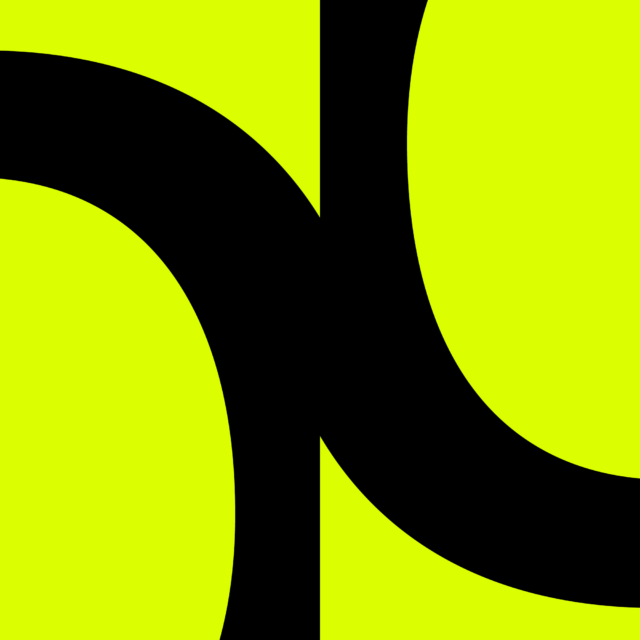
Abonnement
Das Konzert am Samstag ist Teil der Aboreihe Kammerkonzerte.
Werden Sie Abonnent*in des BRSO, sparen Sie bis zu 35% im Vergleich zum Einzelkartenkauf und profitieren Sie von zahlreichen weiteren Vorteilen!