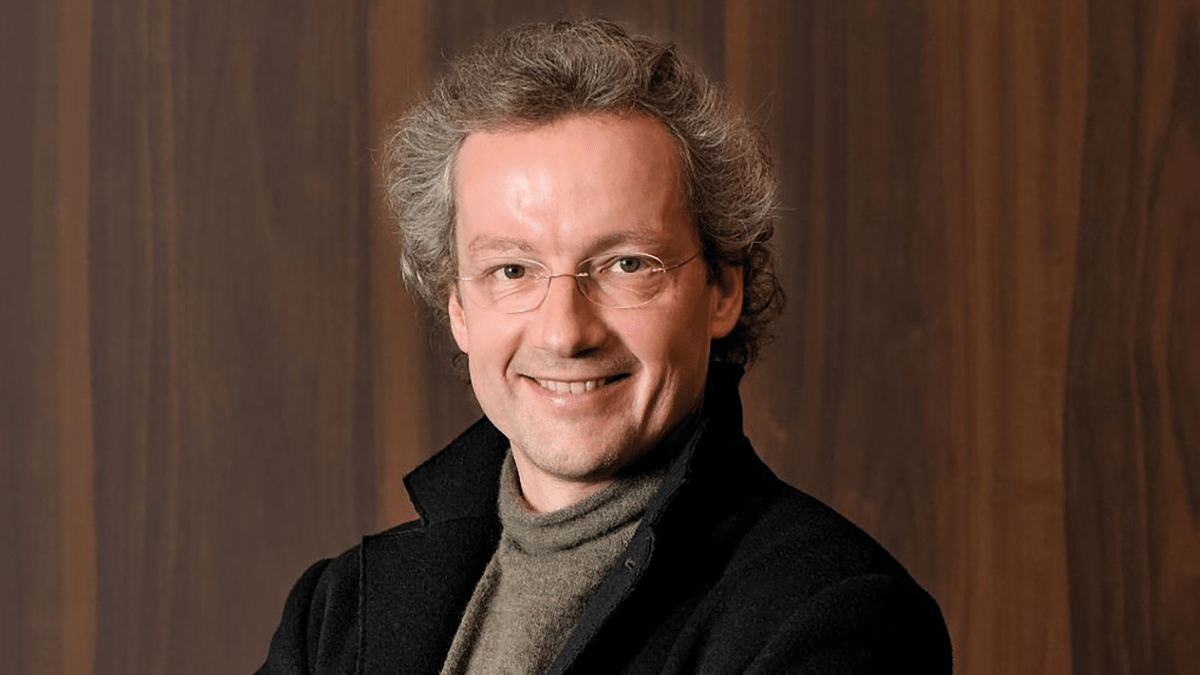Sir Simon Rattle · BRSO hip
Sonntag
9
Februar 2025
11.00 Uhr
München, Prinzregententheater
Vorverkauf ab Dienstag, 3. Dezember 2024, 9.00 Uhr
€ 90 | 75 | 60 | 45 | 32
Sonderkonzert

Programm
Johann Sebastian Bach
»Herr, gehe nicht ins Gericht«, Kantate, BWV 105
Johann Sebastian Bach
»Liebster Gott, wenn werd ich sterben«, Kantate, BWV 8
Johann Sebastian Bach
»Was Gott tut, das ist wohlgetan«, Kantate, BWV 99
Mitwirkende
Sir Simon Rattle
Dirigent
Carolyn Sampson
Sopran
Tim Mead
Countertenor
Thomas Hobbs
Tenor
Konstantin Krimmel
Bariton
Chor des Bayerischen Rundfunks
BRSO hip
Barockensemble
Was steckt hinter »BRSO hip«? Nicht nur die im Englischen gebräuchliche Abkürzung für »historically informed performance«, sondern vor allem die Initiative von Chefdirigent Sir Simon Rattle, das BRSO-Programm um Barockmusik zu erweitern – gespielt auf historischen Instrumenten. Den Auftakt macht der »Chef« selbst mit drei der schönsten Kantaten von Johann Sebastian Bach.